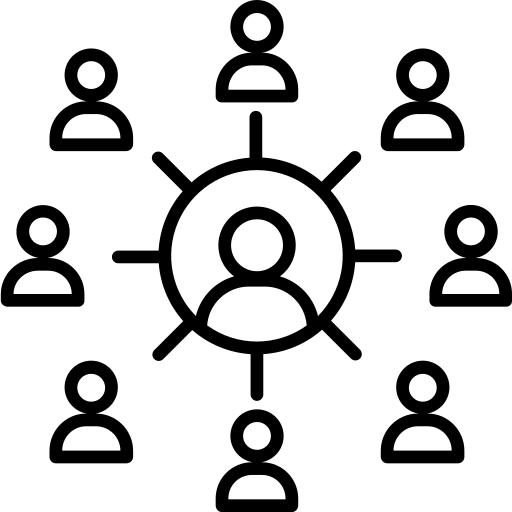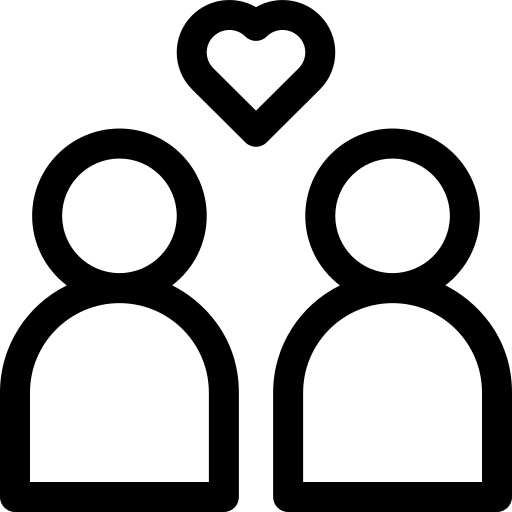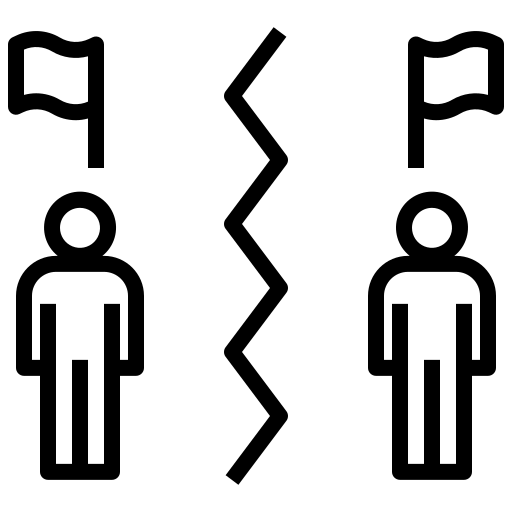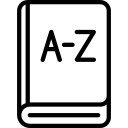Inhalt
Bedürfnisse
Bedürfnisse sind die Basis all unseres Handelns. Wir können sie nicht messen, sie sind eher eine Abstraktion aus unseren körperlichen Prozessen. Ein Bedürfnis zeigt an, wie reibungslos gerade ein b[...]
Grenzen
Jedes System hat Grenzen. Es gibt Teile, die gehören zum System, andere Teile nicht. Ich gehöre z.B. zur Kernfamilie, Tante Trude jedoch nicht mehr. Sie steht im System der Kernfamilie außerhalb. E[...]
Gleichgewicht
Systeme streben nach einem Gleichgewicht, in dem möglichst wenig Energie aufgewendet werden muss und absolut berechenbar ist. Damit sich etwas ändert, muss Energie hinzugefügt werden. Bei sozialen [...]
Hypothesen
Wir benötigen Hypothesen, da wir alles konstruktivistisch betrachten. Das heißt, es gibt keine absolute Wahrheit und somit können wir nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Können wir also ke[...]
Homöostase
Homöostase ist der Prozess, durch den ein Organismus sein inneres Gleichgewicht aufrechterhält, indem er verschiedene Parameter reguliert, um optimale Bedingungen zu gewährleisten. Auf höherer Eben[...]
Innere Teile
Ein innerer Konflikt entsteht, wenn verschiedene Teile in unserem Inneren miteinander interagieren. Diese Teile können abstrakte Konzepte, Emotionen oder sogar fiktive Wesen sein, die unsere innere[...]
Konstruktivismus
Beim Konstruktivismus gibt es keine absolute Wahrheit und jede Meinung ist gleichberechtigt. Wir mögen alle das gleiche sehen – doch nimmt jeder Mensch seine Umgebung anderes wahr, fokussiert[...]
Konflikte
Konflikte sind ein Versuch, ein Gleichgewicht herzustellen. Denn jeder Mensch strebt nach einem Gleichgewicht der Systeme. Allerdings nur, solange diese mit den eigenen Zielen und Wünschen in Einkl[...]
Point of no return
Der „Point of No Return“ (Punkt ohne Rückkehr) bezieht sich auf den Zeitpunkt oder die Situation, an dem eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen wurde – an der es keine Möglic[...]
Ressourcen
Ressourcen sind sämtliche Mittel, Fähigkeiten, Stärken und Potenziale, die Individuen, Paare, Familien oder Organisationen zur Verfügung stehen, um Herausforderungen zu bewältigen, Veränderungen zu[...]
Rückkopplung
Rückkopplung ist ein Prozess, bei dem das Ergebnis einer Handlung oder eines Systems zurück in das System geleitet wird. Dadurch kann das System auf das Ergebnis reagieren und sich anpassen. Dabei [...]
Stressoren
Stressoren sind Faktoren oder Ereignisse, die Stress auslösen oder verstärken und unser Wohlbefinden beeinträchtigen können. Sie können sowohl physische als auch emotionale Reaktionen hervorrufen u[...]
Sicherheit
Sicherheit bedeutet, sich geschützt und geborgen zu fühlen. Es geht darum, Risiken und Gefahren zu minimieren und ein Gefühl der Stabilität und Vorhersehbarkeit zu haben. Sicherheit kann sich auf k[...]
Stabilität
Stabilität ist der Gegenpol zu der Veränderung und zählt zu den Grundbedürfnissen. Diese hat viel mit Grenzen zu tun – bildlich betrachtet ist diese das Material der eigenen Grenze, mit der u[...]
Systemtheorie
Gibt es eine Formel, bzw. Regel, die das Verhalten aller erdenklichen Systeme beschreibt? Sozusagen die Formel aller Formeln? Dieser Frage ging Niklas Luhmann nach und hat die Systemtheorie damit s[...]
Systemisch
Wenn etwas systemisch betrachtet wird, verlassen wir unsere meist wertende Wahrnehmung und betrachten alles als Systeme. Oft bewerten wir gleichzeitig das Wahrgenommene, das wird hier unterlassen. [...]
System
Ein System besteht aus Elementen, die miteinander agieren und in Beziehung zueinander sind. Und das Agieren der Elemente wirkt sich wegen der Rückkopplung auf die anderen Elemente aus. Aufbau Ein S[...]
Strategie
Eine Strategie ist ein planvolles Vorgehen, um bestimmte Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen. Das bedeutet, bewusst bestimmte Denk- und Verhaltensweisen anzuwenden, um Herausforderungen zu me[...]
Veränderung
Veränderung bedeutet, dass sich Dinge in einem System ändern. Ein System kann eine Familie, ein Team oder eine Organisation sein. Veränderung passiert ständig und ist ein normaler Teil des Lebens. [...]
Wandel
Wandel ist der Gegenpol zur Stabilität. Im Gegensatz zur Veränderung, ist der Wandel ein langfristiger Prozess und das Ziel nicht direkt messbar. Dieses liegt in der Zukunft und ist sehr abstrakt. [...]