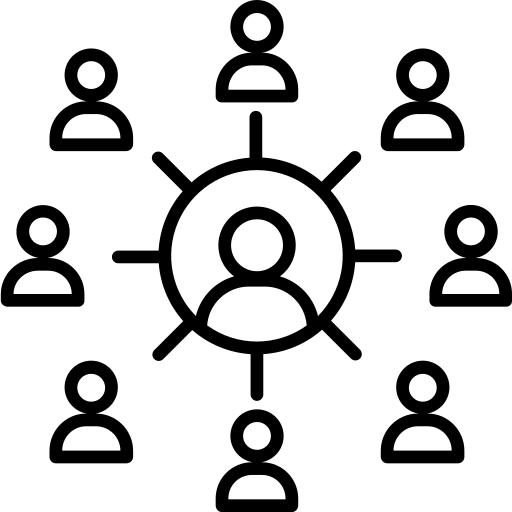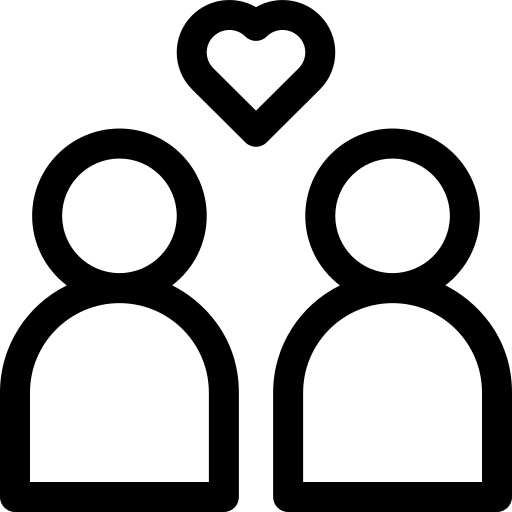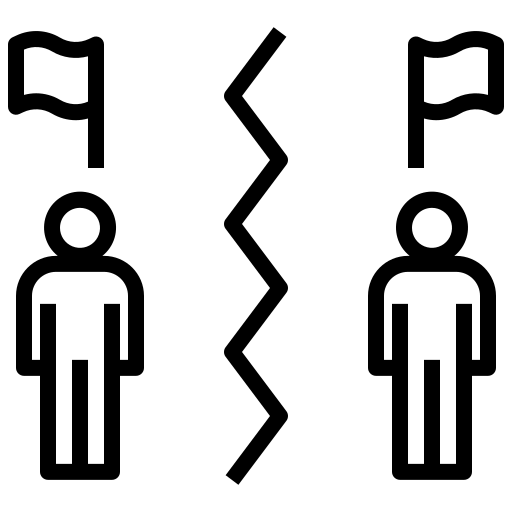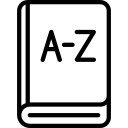Was bedeutet systemisch?
Wenn Ihre Umwelt als System betrachtet wird

Es gäbe jetzt die Möglichkeit, genau zu beschreiben, was ein System ist und wie sich diese auswirken — aber dafür ist das Lexikon da. Hier bleibt es ganz praxisnah. Es wird dargestellt, wie die Systemtheorie bei sozialen Themen einen guten Überblick geben kann, den man sonst nur komplex über andere Wege / gar nicht bekommen hätte.
Familie Becker hat wieder die Ehre, uns Systemisches Wissen aufzuzeigen. Schritt für Schritt begleiten sie uns zu einem besseren Verständnis in der Systemischen Welt.
Grundbedingungen
Bevor wir uns Gedanken über Familie Becker machen, müssen wir noch den Rahmen abklären, in dem wir unsere Annahmen treffen. Wir verwenden hierfür ein positives, Systemisches Menschenbild, welches vom Guten im Menschen ausgeht. Werden böse Taten vollbracht, kann der Mensch in der Situation nicht sehen, wie das dahinter liegende Bedürfnis anders und mit weniger Kollateralschaden erfüllt werden kann.

Menschenbild
Im Systemischen Ansatz gehen wir vom Wachstumsmodell (nach Virginia Satir) aus
- Der Mensch kann und will wachsen. Er will sein menschliches Potential entfalten und sich weiterentwickeln.
- Menschen sind von Natur nicht schlecht oder böse. Auffälligkeiten oder Symptome sind der Ausdruck eines verletzten, gekränkten Menschen.
- Der Mensch kann dazu lernen. Er kann lernen, falsche Annahmen zu korrigieren und seine „Stellungnahme“ zu ändern.
Konstruktivismus
Wir bleiben im Systemischen Menschenbild beim Konstruktivismus. Das heißt, jeder Mensch nimmt nur ein Konstrukt seiner Umgebung wahr. Dieses unterscheidet sich auch von Mensch zu Mensch, da sich jede Person unterschiedliche Aspekte fokussiert und diese auch jeweils unterschiedlich bewertet. Das heißt, jedes Konstrukt ist korrekt und auch gleich gewichtet. Es gibt keine "absolute Wahrheit".

Wer hat Recht? Alle. Laut Konstruktivismus gibt es keine absolute Wahrheit, also hat jede Person nach ihrer Wahrnehmung recht.
Neutraler Blick
Jetzt haben wir langsam akzeptiert, dass jede Person mit ihrer Wahrnehmung recht hat. "Aber mein Partner ist so ein Chaot, er bekommt nichts auf die Reihe. Immer muss man deswegen alles selber machen.". Das ist eine berechtigte Perspektive, jedoch helfen uns Vorverurteilungen nicht, eine Situation besser zu überblicken. Diese machen eher das Gegenteil: Sie ersparen es uns, eine Situation genauer anzuschauen, da wir mit einer einfachen These eine vermeintliche Wahrheit gefunden haben.
Oberstes Gebot: Wir schauen neutral auf die Situation und beschreiben nur, was wir sehen / was gerade passiert. Genauso können wir auf unsere Gefühle eingehen, die wir in der Situation gerade wahrnehmen. So bleiben wir bei uns und vermeiden Bewertungen der anderen Person.

Neutral ausgedrückt: "Wenn du nach Hause kommst, setzt du dich oft gleich auf die Couch und telefonierst. Das macht mich wütend, da mir eine gleichberechtigte Arbeitsteilung wichtig ist, welche ich nicht sehe."
Hypothesen
Die Situation neutral anzuschauen heißt nicht, keine Ahnnahmen mehr zu treffen. Das dürfen wir — jedoch in Form von Hypothesen. Das heißt, wir können eine These aufstellen und diese gilt solange als bestätigt, bis wir einen Widerspruch gefunden haben. Dann stellen wir eine neue Hypothese auf, bei der alles zutrifft. Wir klammern uns niemals an einer Hypothese und versuchen somit auch nie, die Realität so umzubiegen, dass die Hypothese doch zutrifft.
System & Umwelt
Kommunikation ist alles
Wir betrachten in einem System weniger die Menge und Art von Elementen, die innerhalb des Systems existieren, sondern uns interessiert viel mehr die Art der Kommunikation, die darin stattfindet. Dass in einer Familie ein Vater, eine Mutter und ein Kind existieren, ist noch nicht relevant. Viel relevanter ist es, wie die Kommunikation zwischen Vater-/Mutter, Vater-/Kind oder Mutter-/Kind ausschaut. Und was für Wechselwirkung diese Kommunikation auf die anderen Personen hat.
Alles andere: Die Umwelt
Alles außerhalb ist die Umwelt. Was zu System und was zur Umwelt gehört, ist DIE Frage, die Grundlage von ganz vielen Konflikten ist. Person A sagt, Person D gehört zu dem System dazu, für Person B sieht das nicht so.
- Wer darf nach Deutschland einreisen und hier leben, wer nicht
- Wer darf Sozialhilfe bekommen und wer nicht
- Wer wird auf die Geburtstagsfeier eingeladen, wer nicht.
Zwischen der Umwelt und dem System gibt es Wechselwirkungen. Einerseits versuchen Menschen in Systemen, die Umwelt zu beeinflussen, andererseits beeinflusst auch die Umwelt die Systeme. System zu Umwelt Mit unserem Handeln beeinflussen wir immer auch unsere Umwelt. Ob wir wollen oder nicht. Wenn wir mit dem Auto in den Urlaub fahren und im Stau stecken, sind wir ein Grund, warum dieser Stau existiert — neben den anderen Personen, die im Stau stecken. Ohne uns wäre der Stau weniger groß gewesen. Umwelt zu System Von außen kommen immer wieder Ereignisse, die auch Auswirkungen auf unsere Systeme haben. Das können unerwartete Besuche von Verwandten sein, Gesetze, die sich auf uns auswirken oder im schlimmen Fall Katastrophen, die über uns hereinbreichen. In dem Fall müssen wir immer unser bisheriges Verhalten hinterfragen, das im derzeitigen System gepasst hat und ein neues finden, das die neue Situation berücksichtigt.
Ebenen
Oftmals reicht es nicht, nur die Personen und ihre Beziehungen zueinander zu betrachten. Je nach Problem ist es notwendig, mal mehr das Allgemeine zu betrachten (z.B. wie wirken sich gesellschaftliche Regeln / Verhaltensweisen auf uns aus), ein anderes mal in die Tiefe zu gehen und die Emotionen, Bedürfnisse, usw. mit anzuschauen.
Jede Ebene wirkt sich auf die darüber- und darunterliegende aus, deswegen ist es oftmals notwendig, mehrere Ebenen gleichzeitig mit einzubeziehen.

Hier ist das Bedürfnis nach Respekt stark beeinträchtigt, jedoch liegt die Ursache nicht in der Beziehung, sondern in der Arbeit von Heiko. Dort hat er gerade große Probleme mit dem Chef und trägt diese mit nach Hause. Wenn beiden nicht bewusst wird, dass ein Problem aus einem ganz anderen Kontext gerade der Auslöser ist, könnten viele Streits entstehen, die mit einem klärenden Gespräch schnell beseitigt sein könnten.
Grenzen
Der Übergang von System zu Umwelt ist durch Grenzen definiert. Sie geben uns einerseits Sicherheit und Stabilität nach außen, andererseits können uns diese im Wege stehen, so dass wir diese los haben wollen. Eine Grenze zwischen System und Umwelt, die zwei Personen unterschiedlich sehen, ist fast ein Garant für Konflikte — vor allem, wenn Person A mehr Grenze will, Person B jedoch weniger.
Grenzen sichtbar machen
Ein großer Teil der Arbeit im Systemischen ist deshalb das Herausfinden, wo eine Grenze liegt und wie jeder zu dieser steht. Manchmal entdeckt man dabei, dass bei manchen auf einmal innerhalb der Grenze Personen sind, die gar nicht hineingehören (z.B. der Schwiegervater, der zwar nicht da wohnt, trotzdem eine zu große Rolle einnimmt) oder auch Personen ausschließt, die dazugehören möchten.
Hinweis: Wie alles im Systemischen, sind auch die Grenzen konstruktivistisch, d.h. das Konstruckt jeder einzelnen Person. Jede Person kann das anders sehen und es gibt nicht DIE wahre, korrekte Grenze.

Als sie sich gedanklich ihr Familiensystem aufmalt stellt sie fest: Moment, innerhalb der Grenzen ihres Familiensystems ist ihre Schwiegermutter anwesend. Sie gehört da doch gar nicht hin. Sie darf gerne einen Platz außerhalb haben und Kontakt zur Familie haben. Aber nicht mehr als gedanklicher Teil der Familie.
Es wird nicht leicht, der Schwiegermutter das klarzumachen, aber da Susanne den derzeitigen Weg nicht weitergeht und die Familiengrenzen wieder anders justiert, muss sich die Schwiegermutter der neuen Situation anpassen, ob sie will oder nicht.
Bedürfnisse
Unsere Bedürfnisse sind die Grundlage unserer Ziele, wie wir uns Systeme wünschen. Kann das System unsere Bedürfnisse gut erfüllen? Dann kann das System so bleiben, wie es ist. Wenn die Zukunft unklar ist und die Möglichkeit besteht, dass mindestens ein Bedürfnis bei einer Systemänderung nicht mehr so erfüllt wird wie gerade eben, wollen wir das derzeitige System lieber behalten. Manchmal soll es UNBEDINGT so bleiben und wir tun alles, damit eine Änderung nicht stattfindet. Wie bei Paaren, die sich auseinandergelebt haben und alle Energie hineininvestieren, diesen Umstand auszublenden, um die Fassade einer intakten Familie aufrecht zu erhalten.

Erwartungen sind unterschiedlich
Jede Person in einem System hat eigene Erwartungen, wie das System ausschauen soll. Diese Erwartungen können von Person zu Person unterschiedlich sein. Ein kleines Kind wird eine andere Vorstellung davon haben, was die Rolle von Mama, Papa und dem Kind in der Familie ist, als die Mutter oder der Vater. Dabei gibt es keine "absolut richtige" Version eines Systems. Jede Sichtweise ist gleichberechtigt zu den anderen. Siehe Konstruktivismus.

Strategien
Um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, setzen wir Strategien ein. Das heißt, jede Strategie hat das Ziel, mindestens ein Bedürfnis auszugleichen. Leider gibt es keine Super-Strategie, die alle Bedürnisse auf einmal erfüllt. Das wäre wie ein Super-Cheat im Computerspiel "Die Sims".
Gute und schlechte Strategien
Jede Strategie hat ein Ziel und wird dieses mehr oder weniger gut erfüllen. Manche Strategien richten jedoch auch viel Kollateralschaden an, und schaden mehr, als dass sie nutzen. Trotzdem verwenden wir diese, da wir als Kind keine bessere Strategie kannten und als Erwachsene Person noch nicht auf die Idee gekommen sind, die Strategie durch eine bessere zu ersetzen.
Strategien im Unterbewusstsein
Viele denken bei Strategien nur an Aktionen, die wir bewusst tun, nachdem wir nachgedacht- und abgewogen haben, ob das eine gute Idee ist. Diese gibt es auch. Mehr Einfluss haben auf uns jedoch die unterbewussten Strategien. Diese haben wir als Kind gelernt und sind uns so vertraut, dass wir diese einfach anwenden und vielleicht gar nicht hinterfragen, dass wir es anders könnten. "Wenn mich jemand Fremdes anspricht, möchte ich fliehen, obwohl ich eigentlich weiß, dass die Person ganz nett ist..." Hier ist noch eine kindliche Strategie, die im Unterbewusstsein stark verankert ist. Das Bewusstsein agiert bereits wie bei einem Erwachsenen, das Unterbewusstsein hat jedoch noch die Strategien aus der Kindheit. Damals hatten diese einen guten Sinn und waren das Beste, was möglich war — als erwachsene Person könnnte man das sicher besser lösen.

Rückkopplung
Das Besondere an sozialen Systemen ist die Rückkopplung. Mit jeder ausgeführten Strategie wird bei der gegenüberliegenden Person etwas ausgelöst und es gibt eine Gegenreaktion. Wenn Sie freundlich eine Person grüßen, wird in den meisten Fällen auch die gegenüberliegende Person freundlich reagieren. Wenn nicht, wird es eine andere Reaktion geben. Diese Gegenreaktion löst wieder bei Ihnen etwas aus, das wiederum beim Gegenüber etwas auslöst, usw. Das Gegenteil davon wäre zum Beispiel eine Wand, die Sie anschreien. Egal, wie laut oder leise Sie schreien, die Wand wird unabhängig davon so stehen bleiben und nichts tun.
Gleichgewicht / Homöostase
Wenn meherere Personen miteinander interagieren, lässt sich wegen der Rückkopplung nicht vorhersagen, was genau passieren wird, da sich jedes Verhalten auf das andere auswirkt. Oft entsteht jedoch ein Gleichgewicht, auch Homöostase genannt, in dem sich bestimmte Strategien immer wiederholen. In der Evolution stellt sich zum Beispiel oft bei der Anzahl an Jagd- und Beutetieren ein Gleichgewicht ein. Gibt es zu viele Beutetiere, finden die Jagdtiere mehr Beute und die Population steigt, sinkt die Zahl der Beutetiere, überleben auch weniger Jagdtiere, usw.
In der Kommunikation trägt dieses Gleichgewicht dazu bei, dass sich das System nicht ändert, obwohl es womöglich sehr instabil ist. Egal, was eine Person macht, um die Grenzen des Systems zu überwinden, eine andere Person setzt die Grenzen wieder zurück wo sie davor waren. Das nächste mal können beide Reaktionen noch heftiger ausfallen — am Ende werden die Grenzen wieder da sein, wo sie davor gewesen sind.

Konflikte
Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das ist ein sehr bekanntes Sprichwort und trifft leicht verändert auch auf die Kommunikation zu. Wo kommuniziert wird, gibt es auch Konflikte.
Konflikte treten auf, wenn zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinanderstoßen, und die derzeit vereinbarte Strategie nicht beiden Bedürfnissen gerecht wird. Im besten Fall kann durch gute Kommnunikation eine neue Strategie gefunden werden, welche beides erfüllt. Dann ist der Konflikt beseitigt. Oft sind sich die Menschen leider nicht ihren Bedürfnissen bewusst und beschuldigen eher die andere Person, warum sie mit ihrem Verhalten gerade alles eher schlecht machen. Damit ist der Konflikt nicht gelöst, sondern einige weitere dazugekommen. Auch wenn eine Person das System verändern möchte und die andere Person es beibehalten möchte, kommt es zu Konflikten. Die Intensität eines Konflikts ist abhängig von den ungelösten Konflikten aus der Vergangenheit. Je mehr ungelöste Konflikte es in der Vergangenheit gab, desto höher ist die Intensität des Konflikts. Das können auch Konflikte mit völlig anderen Personen sein, jedoch in einem ähnlichen Kontext. Wenn ein Gespräch mit dem Partner wegen einer Nichtigkeit völlig eskaliert, kann es durchaus sein, dass ein Konflikt z.B. mit den Eltern mitschwingt.

Auch hier schwingen Konflikte von Heiko aus der Vergangenheit mit. Die Gründe mögen rational plausibel sein — das Verhalten ist verstärkt durch die Konflikte mit seiner Mutter in seiner Kindheit. Da wurde er regelmäßig angeschrien, warum er die Spülmaschine nicht richtig einräume und er reagierte mit einem beschwichtigenden Verhalten und nahm alle Schuld auf sich. Damit war der Konflikt jedoch nicht gelöst, sondern nur für den derzeitigen Zeitpunkt unterbrochen und ein Garant dafür, dass es in Zukunft bei einem anderen Konflikt mitschwingen wird.
Ein optimales Familiensystem
Leider gibt es keine Zeichnung DES EINEN optimalen Familiensystems, in dem alles gut ist. Sonst wäre ich jetzt reich, könnte Ihnen dieses für viel Geld verkaufen und Sie könnten Ihr Leben dem anpassen und bis zum Ende Ihres Lebens glücklich sein.
Familiensystem können völlig unterschiedlich sein und trotzdem gut laufen. Deswegen gibt es nicht DIE optimale Variante. Allerdings gibt es einige Anzeichen, ob diese gut laufen:
- Die Systemgrenzen sind geklärt und werden nicht von Situation zu Situation angepasst
- Die Systemgrenzen sind so flexibel, dass diese unter neuen Bedingungen auch den neuen Begebenheiten angepasst werden
- Veränderungen werden durchgeführt und nicht so lange zurückgehalten, bis es eskaliert
- Die Kommunikation erfolgt offen und weitestgehend wertfrei
- Die Bedürfnisse jedes Mitglieds werden berücksichtigt.
- Es werden hauptsächlich Strategien eingesetzt, die ihren Zweck erfüllen und nicht viele negative Begleiterscheinungen haben (Gilt vorrangig für die Erwachsenen. Von einem kleinen Kind kann man nicht erwarten, dass es z.B. seine derzeitigen Bedürfnisse klar aufzeigen kann)
Ihre Familiensysteme
Jetzt kommt die spannende Frage: Wie schauen Ihre Familiensystem aus? Was für eine Kommunikation existiert dort und was für Auswirkungen hat dies? Um dies herauszufinden, gibt es 12 Selbstreflexionsfragen für Sie. Falls es etwas komplex wird, können Sie sich auch Notizen oder Skizzen machen.
- Welche Personen existieren in Ihrer Familie und wie ist die Beziehung der Personenen untereinander
- Wer gehört nicht oder nur teilweise zu der Familie?
- Wo sind die Grenzen in der Familie und wer bestimmt diese?
- Wer möchte die Grenzen wo anders haben und versucht durch bestimmte Strategien, diese zu ändern
- Wer versucht die Grenzen beizubehalten, damit keine Veränderung stattfindet?
- Wie schaut der Ablauf dieser Strategien aus? Gibt es eine Rückkopplung und am Ende sogar ein Gleichgewicht?
- Wie wirken sich die derzeitigen Strategien auf Sie aus?
- Was sind die Bedürfnisse bei den Personen, die die Grenzen verändern wollen und was sind die Bedürfnisse bei den Personen, die die Grenzen so lassen wollen?
- Wie würde Sie sich das System vorstellen, wenn es so wäre wie Sie es sich vorstellen?
- Wie stellen sich die anderen Beteiligten das System vor. Fragen Sie diese wenn möglich, ansonsten stellen Sie Hypothesen auf.
- Was müssten Sie tun, damit sich das derzeitige System ändert?
- Welche Bedürfnisse müssten bei den anderne Personen im neuen System (weiterhin) erfüllt werden, damit sie auch einer Systemänderung zustimmen?
Sie haben es geschafft: Sie haben sich mit Ihrem Familien auseinandergesetzt. Was haben Sie für neue Erkenntnisse bekommen? Ich beglückwünsche Sie zu Ihren neuen Erkenntnissen und hoffe, dass diese Sie einen Schritt weiter gebracht haben.
Kontakt
Kontaktformular
Schicken Sie mir gerne eine Nachricht, ich antworte Ihnen innerhalb der nächsten 24 Stunden.